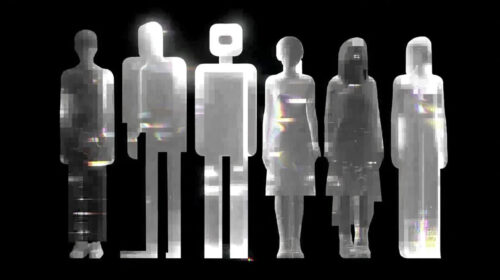Der „Summer of Layoffs“ wird zur „Ära der Ambivalenzen“

Der „Summer of Layoffs“ prägt 2025 und sorgt weltweit für Unsicherheit. Doch während der Sommer kalendarisch vorbei ist, hält die Entlassungswelle unvermindert an: Große Tech-Konzerne, Finanzdienstleister und Start-ups gleichermaßen bauen Personal ab – oft trotz steigender Gewinne. Auf den ersten Blick widersprüchlich, steckt dahinter ein tiefgreifender Wandel: Automatisierung, KI und Effizienzsteigerung werden zur neuen Norm. Doch was bedeutet das für Organisationen, ihre Kultur und die Menschen darin?
Zwischen Kostendruck und Innovationszwang stehen Unternehmen vor der Herausforderung, ihre Narrative neu auszurichten – und dabei die psychologische Sicherheit ihrer Mitarbeitenden nicht aus dem Blick zu verlieren. Die paradoxe Situation unserer Zeit: Während Technologie durch Augmentierung menschliche Potentiale verstärken könnte, wird sie primär genutzt, um Menschen zu ersetzen. Diese Entwicklung birgt Risiken, die weit über kurzfristige Kosteneinsparungen hinausgehen.
Der Wandel hinter den Zahlen
Was steckt eigentlich hinter der anhaltenden Entlassungswelle? Besonders stark betroffen sind die USA, wo bis September fast 950.000 Jobs gestrichen wurden. Auch in Deutschland kühlt der Arbeitsmarkt ab. Und große Konzerne kündigen weitere Entlassungen an.
Oft als KI-getriebenes Phänomen dargestellt, hat der Trend jedoch mehrere Ursachen: Einerseits beschleunigt die Automatisierung durch KI den Wandel. Andererseits rücken viele Unternehmen das zurecht, was im Pandemie-Boom entstand: den Rückbau von Überkapazitäten. In der Corona-Zeit stellten Unternehmen massiv ein, getrieben von scheinbar unbegrenztem Wachstum und günstigen Krediten. Nun folgt die Korrektur.
Transformation trifft auf bestehende Schieflagen wie Fachkräftemangel, hohe Lohnkosten oder schwache industrielle Nachfrage. Organisationen müssen sich neu ausrichten und brauchen besonders umsichtiges Change-Management. Die Herausforderung: Gleichzeitig effizienter werden und die verbleibenden Mitarbeitenden für die Zukunft stärken.
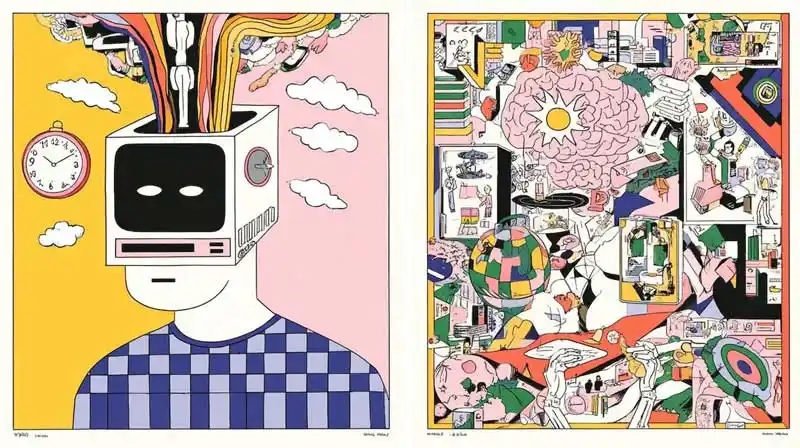
Automatisierung vs. Augmentierung: Warum Augmentierung nachhaltigen Erfolg schafft
Die meisten Unternehmen entlassen derzeit nicht, weil Augmentierung nicht funktioniert, sondern weil sie noch gar nicht auf Augmentierung setzen. Statt Menschen durch Technologie besser zu befähigen, nutzen viele Unternehmen KI aktuell vor allem als Sparhebel.
Besonders in Bereichen wie Content Moderation, Testing, Coding oder Service Operations werden Tätigkeiten zunehmend automatisiert – mit dem Ziel, Kosten zu senken, nicht Kompetenzen aufzubauen. Hinzu kommt, dass viele Organisationen noch am Anfang ihrer Transformation stehen. KI wird oft als kurzfristige Lösung betrachtet, um Effizienz zu steigern, nicht als Innovationsmotor für neue Geschäftsmodelle und Arbeitsweisen. Entsprechend fehlt häufig ein langfristiger Plan, wie Mitarbeitende mit Technologie wachsen können und neue Rollen entstehen.
Genau hier liegt der entscheidende Unterschied: Automatisierung kann kurzfristig Kosten sparen, doch nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit entsteht durch Augmentierung. Sie nutzt Technologie, um menschliche Fähigkeiten zu verstärken, nicht zu ersetzen. Statt Menschen gegen Maschinen auszutauschen, entstehen kraftvolle Mensch-Maschine-Teams, die sowohl die analytische Präzision der KI als auch die Kreativität, Empathie und Urteilskraft des Menschen nutzen. Unternehmen, die Technologie gezielt einsetzen, um Menschen zu befähigen, bleiben resilienter, innovationsfähiger und attraktiver für Talente.
Lesetipp: Eine Utopie der Arbeitswelt: Wie Künstliche Intelligenz Organisationen menschlicher macht
Kultureller Kollateralschaden: Der Impact von Entlassungswellen auf Organisationsentwicklung
Wenn Beschäftigte erleben, dass Kollegen ohne Vorwarnung „freigesetzt“ werden, während gleichzeitig in neue Software investiert wird, sendet das eine eindeutige Botschaft: Menschen sind Kostenfaktoren, nicht Wertschöpfer. Entlassungen verändern Organisationen weit über ihre Strukturen hinaus. Sie hinterlassen emotionale Spuren – auch bei den verbleibenden Mitarbeitenden.
Vertrauensverlust entsteht, wenn Mitarbeitende an der Stabilität der Organisation zweifeln. Wer heute noch da ist, kann morgen gehen müssen – diese Unsicherheit lähmt Initiative und Engagement.
Das Leistungsparadoxon beschreibt ein weiteres Phänomen: Aus Angst vor Jobverlust arbeiten viele mehr, verlieren aber Kreativität und Innovationskraft. Überstunden ersetzen keine Qualität, Aktionismus ersetzt keine strategischen Entscheidungen.
Der Kollaps der Kultur zeigt sich, wenn Werte wie Zusammenhalt, Sicherheit und Zugehörigkeit ins Wanken geraten. Informelle Netzwerke des Austauschs verschwinden, wenn Menschen sich nicht mehr trauen, offen zu sprechen.
Silos und Arbeit nach Vorschrift entstehen, wenn Mitarbeitende Wissen horten, Risiken vermeiden und sich darauf konzentrieren, unersetzlich zu erscheinen, statt Wert zu schaffen.
Gerade in Zeiten tiefgreifender Transformation ist das fatal. Denn ohne eine intakte Unternehmenskultur verlieren Unternehmen nicht nur Talente, sondern auch ihre Zukunftsfähigkeit. Innovation erstickt, da niemand bereit ist, disruptive Ideen zu teilen, die möglicherweise den eigenen Job überflüssig machen könnten.
Psychologische Sicherheit als strategische Ressource
Der Begriff der psychologischen Sicherheit – geprägt von Amy Edmondson – beschreibt, wie sicher sich Mitarbeitende fühlen, Risiken einzugehen, Fehler zuzugeben und Ideen einzubringen. In Umbruchszeiten entscheidet sie über Erfolg oder Scheitern.
Hohe psychologische Sicherheit fördert Innovation, Zusammenarbeit und Lernbereitschaft. Geringe psychologische Sicherheit hingegen führt zu Angst, Silos und Rückzug. Menschen entwickeln „defensive Routinen“, verstecken Probleme und vermeiden schwierige Gespräche.
Gerade jetzt, wo Technologien Arbeitsrealitäten verändern, brauchen Menschen Räume, in denen sie experimentieren dürfen. Organisationen müssen aktiv daran arbeiten, Vertrauen zu stärken und Transformation als gemeinsamen Prozess zu gestalten. Psychologische Sicherheit wird zur strategischen Ressource, die über die Adaptionsfähigkeit von Unternehmen entscheidet.

Transformation braucht Narrative – und Angebote
Ein entscheidender Erfolgsfaktor in dieser Situation ist das Transformationsnarrativ. Mitarbeitende brauchen eine gemeinsame Geschichte, die Sinn stiftet und Orientierung bietet. Menschen sind Geschichtenwesen – sie verstehen Veränderungen besser, wenn sie in einen größeren Kontext eingebettet sind.
Ehrliche Kommunikation mit klaren Botschaften zu Veränderungen und deren Gründen. Führungskräfte müssen erklären, warum bestimmte Entscheidungen getroffen werden, ohne dabei in Beschönigung zu verfallen.
Zukunftsbilder schaffen positive Perspektiven, die Mitarbeitende mitnehmen. Statt nur über Herausforderungen zu sprechen, müssen Organisationen aufzeigen, wie die Zukunft aussehen kann und welche Rolle jeder Einzelne darin spielt.
Konkrete Angebote machen Narrative glaubwürdig: Weiterbildung, Coaching, neue Rollenmodelle und Technologien, die Menschen befähigen, statt sie zu ersetzen. Wer Transformation predigt, muss auch in die Entwicklung der Menschen investieren.
Von Krisenmodus zur augmentierungsbasierten Transformation
Der Übergang zu einer augmentierungsorientierten Organisation erfordert strategisches Vorgehen und Umbruch als Chance zu begreifen.
Diagnose vor Therapie: Bevor Technologie implementiert wird, müssen die tatsächlichen Schmerzpunkte identifiziert werden. Oft liegen die Wurzeln von Effizienzproblemen nicht in mangelnder Automatisierung, sondern in unklaren Prozessen, fehlender Kommunikation oder inadäquaten Arbeitsmethoden. Eine gründliche Analyse verhindert, dass Technologie lediglich schlechte Prozesse beschleunigt.
Co-Creation statt Implementation: Mitarbeitende sind die Expert:innen ihrer eigenen Arbeit. Augmentierungslösungen, die ohne ihre Beteiligung entwickelt werden, scheitern häufig oder werden umgangen. Erfolgreiche Transformationen entstehen in enger Zusammenarbeit zwischen IT, Führung und den betroffenen Teams.
Pilot- statt Vollausrollung: Augmentierungsstrategien profitieren von iterativen Ansätzen. Kleine Pilotprojekte ermöglichen es, Technologie und Prozesse zu testen, Feedback einzusammeln und Anpassungen vorzunehmen, bevor größere Investitionen getätigt werden.
Reskilling statt Replacing schafft neue Kompetenzen – beispielsweise in KI, nachhaltigen Technologien oder agiler Führung. Menschen benötigen neue Fähigkeiten, um erfolgreich mit intelligenten Systemen zu arbeiten. Diese Weiterbildung darf nicht als Kostenfaktor betrachtet werden, sondern als strategische Investition in die Zukunftsfähigkeit der Organisation.
Kultur als Katalysator: Kultur ist kein „Soft-Faktor“, sondern der Motor für Resilienz und Leistungsfähigkeit. Organisationen mit starker Innovationskultur überstehen Krisen besser und nutzen Veränderungen als Wachstumschance.
Narrative für Zuversicht: Führungskräfte müssen Geschichten erzählen, die Orientierung geben, ohne Probleme zu beschönigen. Transformation gelingt nur, wenn Menschen den Sinn hinter Veränderungen verstehen.
Lesetipp: Menschenzentrierte KI: Der Schlüssel zur nachhaltigen Transformation der Arbeitswelt

Fazit: Augmentierung als Zukunftsstrategie
Die aktuellen Entlassungswellen sind Ausdruck einer doppelten Transformation: der Korrektur vergangener Überexpansion und des Aufbruchs in eine KI-getriebene Zukunft. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, diesen Wandel aktiv zu gestalten.
Die Unternehmen, die aus dieser Krise gestärkt hervorgehen, werden jene sein, die erkannt haben: Die Zukunft gehört nicht Maschinen, die Menschen ersetzen, sondern Menschen, die Maschinen meistern. Wer jetzt auf Augmentierung statt reiner Automatisierung, auf psychologische Sicherheit und auf gemeinsame Zukunftsnarrative setzt, schafft die Grundlage für nachhaltigen Erfolg.
Die Botschaft ist klar: Transformation gelingt nur mit den Menschen, nicht gegen sie. Organisationen, die das verstehen und entsprechend handeln, werden nicht nur effizienter, sondern auch menschlicher, innovativer und zukunftsfähiger.
Du möchtest mehr erfahren? Dann lese hier alles über KI-integrierte Teams: Handbuch KI-integrierte Teams
Weitere Leseempfehlungen:

Verfasst von:
Désirée Seibel