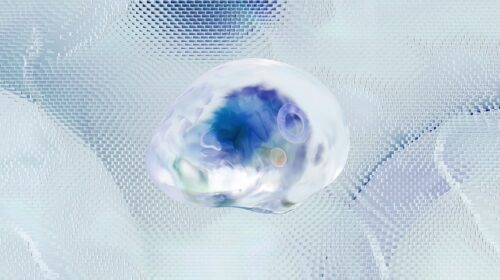Strategiearbeit gilt oft als die Königsdisziplin der Unternehmensführung: Visionen formulieren, Schwerpunkte setzen, die Organisation ausrichten. Und doch scheitern viele strategische Vorhaben nicht an fehlender Ambition – sondern daran, dass die nötigen Ressourcen schlicht nicht bereitstehen. Oder schlimmer: dass Budgets vergeben wurden, ohne je über ihre strategische Relevanz nachzudenken.
In vielen Unternehmen sind Ziel- und Budgetprozesse strukturell voneinander entkoppelt. Das klingt zunächst harmlos, führt in der Praxis jedoch zu einer Schieflage: ambitionierte Ziele, denen niemand Mittel hinterlegt und teure Programme, deren Beitrag zur Strategie niemand so recht benennen kann. Was fehlt, ist ein integrierter Steuerungsmechanismus, der Strategie, Ziele und Mittel systematisch im Sinne einer integrierten Steuerung verbindet.
Das Problem: Warum Ziel- und Budgetprozesse selten zusammenpassen
Diese Trennung von Budget und Zielen ist kein Zufall. Sie hat sich historisch eingeschliffen, gespeist durch die Arbeitsteilung zwischen Strategie- und Finanzverantwortlichen. Die einen definieren „wohin es gehen soll“, die anderen „was es kosten darf“. Was dabei oft fehlt, ist ein klares „Wie“.
Diese Herausforderung ist in der Forschung gut dokumentiert. So argumentieren Libby & Lindsay (2010), dass traditionelle Budgetprozesse zwar Stabilität bieten, aber zunehmend als „strategisch blinde“ Systeme kritisiert werden – insbesondere, wenn sie losgelöst von Zielsystemen wie Balanced Scorecards oder OKRs (Objectives and Key Results) verwendet werden.
In vielen Organisationen sind Budgetprozesse stark vergangenheitsbezogen – sie extrapolieren das, was im Vorjahr war, und verteilen Ressourcen entlang bestehender Strukturen. Strategische Zielsysteme hingegen richten sich bewusst auf Veränderung. Die Folge: Während Ziele in Richtung Zukunft streben, konservieren Budgets die Vergangenheit, statt die Zukunft zu ermöglichen.
Zudem fehlt häufig ein gemeinsames Steuerungsmodell: Auf welches Ziel zahlt eine Maßnahme ein? Welche Wirkung ist erwartet? Wie hoch ist der nötige Mitteleinsatz? Wann tritt der Effekt ein? – Diese Fragen bleiben unbeantwortet, wenn Ziele und Budgets in separaten Silos entstehen.
Die Lösung: Eine Kopplung von Zielen mit Budgets
Die Lösung liegt nicht in neuen Tools, sondern in einer veränderten Haltung: Strategische Zielerreichung muss als Investitionsentscheidung begriffen werden. Wer ein ambitioniertes Ziel verfolgt, braucht Veränderung und Veränderung erfordert Ressourcen. Und wer Ressourcen vergibt, sollte wissen, wie diese auf die Ziele einzahlen.
Integrierte Modelle setzen genau hier an. Sie koppeln Zielsysteme wie OKRs direkt mit der finanziellen Planung. Als Methode zur Strategieumsetzung bringen OKRs gleich mehrere Vorteile mit: Sie sind fokussiert, transparent, messbar – und sie fördern die Koordination über Bereichsgrenzen hinweg.
Wenn Key Results zusätzlich als Budgetanker genutzt werden, gewinnen sie eine neue Relevanz: Sie zeigen nicht nur, was erreicht werden soll, sondern definieren auch, welche Investitionen sich lohnen. Die OKRs fungieren dann als verbindendes Element zwischen Strategieformulierung und Finanzplanung. Das Prinzip: kein Budget ohne Ziel – und kein Ziel ohne Wirkungshypothese.
Wissenschaftliche Studien stützen diesen Ansatz: Forschungen zu integrierten Steuerungsmodellen zeigen, dass Unternehmen, die Budgets und strategische Ziele verbinden, erfolgreicher bei der Umsetzung ihrer Vorhaben sind. Dabei erweisen sich OKRs als besonders anschlussfähig – insbesondere, wenn sie nicht nur als Kommunikationswerkzeug, sondern als Entscheidungsgrundlage im Budgetprozess genutzt werden.
Praktische Umsetzung: Wie integrierte Steuerung konkret aussieht
In der Praxis bewährt sich ein abgestuftes Vorgehen: Zunächst legt die Unternehmensleitung die strategischen Ziele und Prioritäten für das kommende Jahr fest – idealerweise bereits in der Logik von OKRs. Diese Vorgaben bilden den Rahmen für die Planungsarbeit der Bereiche.
Die einzelnen Geschäftseinheiten definieren daraufhin Initiativen, mit denen sie auf die übergeordneten Ziele einzahlen wollen. Jede dieser Initiativen wird nicht nur inhaltlich beschrieben, sondern auch finanziell unterlegt: Wie hoch ist der zusätzliche Aufwand? Welche Wirkung wird erwartet? Wann tritt sie ein?
Entscheidend ist dabei die Trennung zwischen Basisbetrieb („Run“) und Veränderung („Change“) – und zwischen laufenden Kosten und zusätzlichen Investitionen. So lassen sich operative Belastung, Transformationstempo und Kapitalbindung gezielt steuern.
Die Initiativen mit ihren Effekten werden dann in Key Results gebündelt, denen jeweils ein Budget mit den benötigten “Change” Ressourcen anhaftet.
Zudem werden Budgetfreigaben nicht pauschal erteilt, sondern etappenweise entlang definierter Entscheidungspunkte (Gates). Erst wenn eine Maßnahme bestimmte Fortschritte nachweist – etwa in einem Pilotprojekt oder durch erste Ergebniskennzahlen – wird die nächste Finanzierungsrunde freigegeben. Diese Logik erlaubt Stop/Go-Entscheidungen, verhindert Blindleistung und stärkt die integrierte Steuerung.
Warum sich dieser Aufwand lohnt
Ein solches Vorgehen bringt eine neue Qualität in die Steuerung von Organisationen. Budgets werden nicht mehr verwaltet, sondern als strategisches Mittel eingesetzt. Ziele sind nicht mehr nur Leitplanken, sondern konkreter Maßstab für Ressourcenzuteilung. Und Verantwortlichkeiten werden dort verankert, wo Wirkung entsteht.
Gerade für CFOs und Finanzverantwortliche ergibt sich durch integrierte Steuerung ein echter Mehrwert: Sie behalten die Kosten im Blick, gewinnen aber zusätzlich ein schärferes Bild von der strategischen Wirksamkeit einzelner Maßnahmen. Gleichzeitig können sie Budgets flexibler handhaben, da Mittel an Ergebnisse geknüpft und bei Bedarf umverteilt werden können.
Für Strategie- und Transformationsteams wiederum entsteht die Chance, Veränderung nicht nur zu konzipieren, sondern sie auch finanziell abzusichern. Der Budgetprozess wird zum Hebel für Umsetzung – nicht zum Hindernis.
Fazit: Ziele und Budgets sind zwei Seiten derselben Medaille
Strategie braucht Ressourcen. Und Ressourcen brauchen Richtung. Wer beides in getrennten Prozessen plant, riskiert Leerlauf, Überforderung oder Fehlallokation. Wer beides jedoch verbindet, schafft eine Organisation, die weiß, was sie erreichen will – und auch die Mittel hat, es umzusetzen.
Die Verknüpfung von OKRs mit der Budgetplanung ist dabei kein Selbstzweck, sondern ein Instrument für bessere Entscheidungen, klarere Prioritäten und höhere Wirksamkeit. In Zeiten knapper Mittel und wachsender Komplexität kann genau das den Unterschied machen – zwischen Strategie, die bleibt, was sie war: ein schönes Papier. Und einer, die wirkt.

Verfasst von:
Jonas Holzfäller
Innovative Lösungen, die unsere Welt einfach, unkompliziert und schöner machen treiben Jonas in seiner Arbeit als Organisationsdesigner an. Sein Ziel ist es, Organisationen zu entwickeln, die es Menschen ermöglichen innovative Ideen hervorzubringen. Ko-kreativ gestaltet und implementiert er strategische Lösungen, die zu den individuellen Bedürfnisse von Mensch und Organisation passen.